 | ||||||||||
|
|
| Flugplatz in Körbin bei Pretzsch |
| Der ehemalige Pretzscher Flugplatz in Körbin bei Pretzsch an der Elbe war nach dem 2. Weltkrieg ein Durchgangs- und Quarantänelager für Tausende ehemalige Kriegsgefangene und Vertriebene aus dem Osten. |
| 1947 lebten in Pretzsch über 1200 Heimkehrer und Flüchtlinge. Pretzsch hatte damals mit den umliegenden Dörfern ca. 1800 Einwohner. Der Bezirksbürgermeister von Bad Schmiedeberg …. berichtete in einem Schreiben vom 24. Januar von 4000 Menschen.
1949 wurde hier eine Polizeihundeschule für das Land Sachsen-Anhalt eingerichtet. Es wurde eine Lehrgangsstätte für ca. 130 Polizeiangehörige und eine Belegung mit 200 Hunden geschaffen. Zerlumpt und verlaust kamen die aus sowjetischer Gefangenschaft entlassenen Soldaten nach Körbin in Quarantäne. Die Kleidung wurde sofort verbrannt. Zeitweise musste das Lager wegen Seuchengefahr geschlossen werden. „Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die in der Einrichtung stationierten Lagerinsassen nicht in den Gemeinden herumlaufen“, schrieb der Bezirkbürgermeister. Das Lager unterstand der Sowjetischen Militäradministration unter den Kommandanten Hauptmann Wanja Oleschenko, die den deutschen Leiter Josef Wagner eingesetzt hatte. Am schwierigsten war es mit der Versorgung. Hier half uns die Kommandantur der Roten Armee unter Hauptmann Wanja Oleschenko. Wie auch Wagner, der immer wieder versucht habe, auf dem Land für die Bewohner Extra- Gemüse zu ergattern. Schwer war das Leben der Flüchtlinge. Viele litten unter einem Lagerkoller. „Ich bitte um Beschäftigung bei einem Bauer; ich frage nicht nach Bezahlung“, schrieb ein Familienvater an den Bürgermeister. „Ich bin aus Schlesien und kann vorläufig nicht zurück. Ich weiß nicht, wo meine Familie ist. Der Bauer Wilhelm Schwerdt benötigte dringend Arbeitskräfte für die Bewältigung seiner Arbeit in der Landwirtschaft. Nachdem sich der Vertriebene beim Lagerleiter abgemeldet hatte, konnte er bei Schwerdts arbeiten und schlafen. Viele Hilferufe kamen aus dem Lager. Dokumente des Mangels und der Verzweiflung befinden sich in einem vergilbten Aktenordner im Rathaus der Stadt. Die angespannte Situation bestätigt ein Aufruf des Wittenberger Landrats an die Bevölkerung zur Kleiderspende vom 26. September 1946: „Die heimatlosen Heimkehrer sind die bedauernswertesten Menschen unter uns Deutschen und müssen durch Sammelungen endlich ihre Freiheit wieder gelangen. Arbeiter, Bauern und Angestellte, befreit durch Eure Spende einen Unglücklichen vom Stacheldraht!“. Auch eine Aktion „Rettet die Kinder“ war sehr erfolgreich. Für die Organisation der Versorgung der Menschen im Lager war das Hilfswerk der damaligen Provinz Sachsen verantwortlich. Die Menschen, die bei ihrer Ankunft in Körbin kaum mehr besaßen, als sie am Leib trugen litten nicht nur materielle Not. Ursula Rothenburg aus Luckenwalde berichtete: „Ich meldete mich bei Frau Steuer vom Roten Kreuz und die teilte mich einem Flüchtlingsbahntransport nach Stendal zu. Zusammen mit noch einer Schwester vom Roten Kreuz und einem Arzt brachte man uns zum Güterbahnhof von Luckenwalde. Die Flüchtlinge saßen unter katastrophalen Bedingungen in Viehtransportwagen, nur mit dem Nötigsten ausgerüstet. Jeder hatte ein Stück Brot und etwas Marmelade bekommen. Am späten Abend des 22.12.1945 startete mit vielen Unterbrechungen der Transport vom Güterbahnhof Luckenwalde. In Stendal angekommen, wurde der Transport dort nicht angenommen. Aus dem Zug wurden die Toten (vier Erwachsene und ein Kind) heraus getragen. Wir Schwestern wechselten in der Zeit Verbände und kümmerten uns um die völlig verängstigten Flüchtlinge. Der Zug setzte sich in Richtung Pretzsch in Bewegung. Am Ziel setzte sich der Arzt ab und ich war nun die einzige Verantwortliche auf diesem 8oo-Flüchlinge-Transport. Die sich in einem erbärmlichen Zustand befindlichen Flüchtlinge wurden im Flüchtlingslager Pretzsch aufgenommen. Ich fuhr dann ab Pretzsch über Jüterbog nach Luckenwalde, wo ich am 24.12.1945 ankam. Die Vertreibung aus der Heimat hatte traumatische Folgen. Als selbstmordgefährdet wurde eine Mutter eingestuft, die mit ihren 4 kranken Kindern im Lager lebte. Die Stadtverwaltung bemühte sich die Flüchtlingsfrau ein einer thüringener Gemeinde unterzubringen, wo ihre Schwester lebte. Ohne Zuzugsgenehmigung war ein legaler Ortwechsel nicht möglich. Krieg und Vertreibung hatte Familien auseinander gerissen. Glücklich war derjenige, der Verwandte ausfindig machen konnte. „Er hat einen verbrannten Oberschenkel“, lautete eine der im Lager ausgehängten Suchmeldung. In das Heimatmuseum in Pretzsch kommen Besucher, die etwas über Durchgangs- und Quarantänelager in Körbin wissen wollen. Viele Kinder und Enkel wussten nicht, dass ihr Vater in dem Lager war. Erst bei der Haushaltsauflösung der Eltern fanden sie einen Entlassungsschein. Die Kinder fanden im Nachlass ihrer Väter Dokumente, das sie in diesem sich aufgehalten haben. Viele Soldaten, die aus sowjetischen Gefangenenlagern kamen, waren meistens krank. So starben einige Soldaten in Körbin. Sie wurden bestattet in einem Massengrab auf dem Friedhof in Bad Schmiedeberg. Vor einigen Jahren besuchten das Heimatmuseum drei Brüder, die ihre Jugend in Zeitz verbrachten hatten und sich für das Leben ihres Vaters interessierten, der im September 1946 im Durchganglager war. In Körbin ist der Familienvater gelandet auf dem Heimweg aus der Gefangenschaft am Ural. Nach seiner Enlassung ist er zu Fuß in seine Heimat nach Zeitz gelaufen. Die Brüder übernachteten im Parkhotel. Am nächsten Tag, noch vor Sonnenaufgang, ging es per pedes nach Zeitz. Ein älterer Besucher kam in das Heimatmuseum. Er hatte seine Eltern und Angehörige in den Kriegswirren verloren. „Die Vergangenheit muss man peu a’peu absetzen und auf die Zukunft setzen“. Absetzen ist sein Wort für verarbeiten. |
| Informationen | |
| Heidemagnet | |
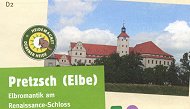
|
|
| • Heidemagnet im Internet | |
|
|
|
| Schwimmhalle | |

|
|
| • Link zur Webseite | |
|
|
|
| Heidi Magazin | |

|
|
| • www.heidimagazin.de | |
| Geschützte Bäume | |
Eiche an der Neumühle Gemeine Rosskastanie am Golmer Weinberg  |
|
